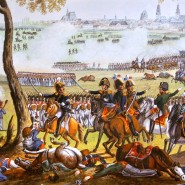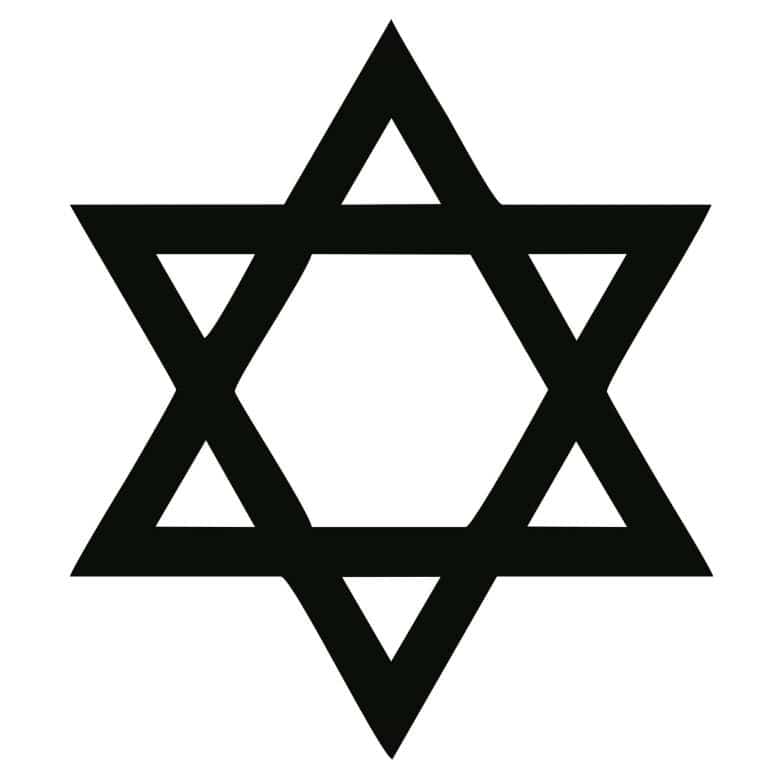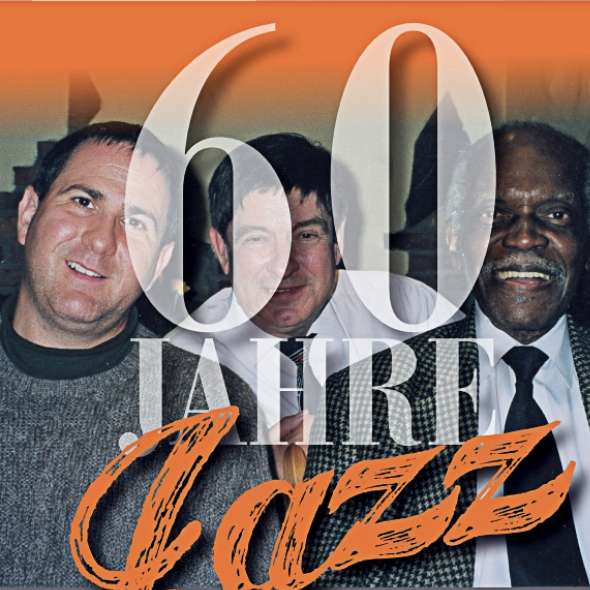Die HOLA im Kommunikationsraum: Das Korrespondenznetzwerk der HOLA-Professoren vom 17. bis ins 19. Jahrhundert
Projektbeschreibung
Die Hohe Landesschule (Hola) firmierte bis 1812 als Semi-Universität. Daher unterrichteten an ihr neben „einfachen“ Präzeptoren (Lehrer) am Pädagogium (einfaches Gymnasium oder gymnasium inferiori) auch Professoren an der Akademie (gymnasium illustre). Der Lehrbetrieb war am gymnasium illustre in vier Fakultäten (Theologie, Jura, Medizin, Philosophie) in Anlehnung an die septem artes liberales angelehnt, d. h. an der mittelalterlichen Einteilung des gelehrten Wissens orientiert.
Dabei ist die Geschichte der Hola bislang nur die Anfangsphase unter Philip Ludwig II. und Katharina Belgica erforscht. Diese Forschungen liegen bereits 150 Jahre zurück und entstammen aus dem Kontext von Schuljubiläen. Einzelne Aufsätze für das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert liegen aus der Feder Jürgen Osterhammels vor. Die Geschichte der Hola im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts liegt dagegen im Dunkeln. Dies gilt sowohl für die eigentliche Institutionengeschichte als auch für die lokale, regionale und überregionale Breitenwirkung der Hola und ihrer Verflechtung in der akademischen Welt der Frühen Neuzeit. Erschwerend kommt hinzu, dass den akademischen Gymnasien mit einzelnen Ausnahmen bislang nur wenig Aufmerksamkeit in der Forschung geschenkt wurde.
Nur der 80 Jahre alte Aufsatz Heinrich Botts wirft mit seinen Kurzbiografien der Hola-Professoren einen ersten Einblick in die Lebenswelt des akademischen Personals. Indessen konnte Bott zeitbedingt lediglich auf die Quellen zurückgreifen, die ihm zur Verfügung standen und die in der Regel im Stadtarchiv Hanau und im Staatsarchiv Marburg zu finden sind. Insofern konnte Bott nachvollziehbarer Weise keine Aussagen darüber treffen, wie die jeweilige Vernetzung der Hola-Professoren in die akademische Community aussah. Dabei ist in Botts Aufsatz eine eklatante Leerstelle zu konstatieren: Bott verliert über die ersten Professoren der Hola kein einziges Wort (v. a. Johann Philipp Pareus, Paul Tossanus).
Ein erster Zugang zur Klärung dieser Fragen, welchen Stellenwert die Hola in der akademischen Welt der Frühen Neuzeit hatte, lässt sich unter anderem über den Aspekt der historischen Netzwerkforschung schaffen. In den ersten zweihundert Jahren ihres Bestehens unterrichteten einige bedeutende Persönlichkeiten an der Hohen Landesschule. Diese unterhielten wiederum Briefkontakte zu herausragenden Persönlichkeiten der damaligen Wissenschaftswelt. Diese Briefe waren in der lingua franca der damaligen Wissenschaftselite abgefasst: dem Latein. Diesen Briefen widmet sich das Teilprojekt zum Korrespondenznetzwerk der Hola-Professoren im Rahmen der Erforschung der Hohen Landesschule als spezifischer Schulform der Frühen Neuzeit. Die Bedeutung eines solchen Vorhabens liegt auf der Hand:
- Es können Netzwerke identifiziert werden, in denen die Hola-Professoren eingebunden waren, indem analysiert wird, wer die Korrespondenzpartner waren und welchen Stellenwert sie in der Wissenschaftswelt der Frühen Neuzeit hatten.
- Es können Ströme des Kultur- und Wissenstransfers ermittelt werden, indem exemplarisch eruiert wird, was in den Briefen thematisch behandelt wird und welchen Niederschlag dies in weiterer Folge auf den Lehrbetrieb an der Hola hatte.Die Recherche dieser Briefe erfolgt über die Portale Kalliope und Early Modern Letters. Für das Frühe 17. Jahrhundert wird zudem auf die Hartlib Papers zurückgegriffen. In Einzelfällen kommen Datenbanken berühmter Persönlichkeiten (Leibniz, Haller, Goethe, Schleiermacher), Archivportale oder Datenbanken einzelner Sammlungen an Univeristäts- und Landsbibliotheken (Stabi Hamburg, UB Frankfurt) hinzu.
Methodik
Die Auswertung der bisher vorliegenden Korrespondenz wurde zunächst über einen quantitavien und biografischen Zugang vorgenommen: Nach vereinheitlichten Kriterien wurden zunächst die Biografien der Hola-Professoren und ihrer Briefpartner recherchiert. Danach wurde die Anzahl der Korrespondenz mittels einer csv-Datenbank erhoben und via Palladio visualisiert.
Im darauffolgenden Schritt ging es darum, die Verbindungen der Korrespondenzpartner unter einander zu erheben. Dies geschah mithilfe mittelst einer einfachen Abfrage via Kalliope und Early Modern Letters. Die Angaben wurden dann in das Programm Gephi übertragen. Während die direkten Briefkontakte der Hola-Professoren zu ihren Korrespondenzpartnern als gerichtete Verbindung aufgeführt wurden, d.h. grafisch dargestellt wird, in welche Richtung der Kontakt ging, so wurde bei den Kontakten der Korrespondenzpartner untereinander ungerichtete Verbindungen gewählt. Hierbei sollen nur die Querverbindungen zwischen den betreffenden Personen dargestellt werden, um die Vernetzung und damit den Kommunikationsraum unter den Beteiligten zu verdeutlichen. Der Eindruck einer gleichsam exakten mathematisch-grafischen Darstellung darf aber an dieser Stelle nicht entstehen. Vielmehr handelt es sich zunächst einmal einzig und allein darum, die Kommunikationsräume und deren Wandel respektive Verschiebung im zeitlichen Vergleich darzustellen. Zudem sollen durch die Darstellung der persönlichen Konstellationen erste Hinweise für die qualitative Auswertung erbracht werden.
Erste Projektergebnisse
A Auswertung zum Korrespondenznetzwerk im 17. und frühen 18. Jahrhundert (Bild 1):
Das Korrespondenznetzwerk im 17. und frühen 18. Jahrhundert lässt sich in zwei Hälften teilen: Zum einen das Netzwerk rund um die ersten Hola-Professoren Pareus und Tossanus, zum anderen vor allem in die Netzwerke rund um Bashuysen, Klingler, Hase und Schweizer.
Im ersteren Falle standen vor allem Korrespondenzpartner aus dem schweizerischen Reformiertentum im Mittelpunkt der Kommunikation. Hierzu zählten neben den Vätern der beiden genannten Professoren – ebenfalls herausragende reformierte Theologen – vor allem Théodore de Bèze als einer der Hauptreformatoren in der Schweiz (daneben gibt es verwandtschaftliche Beziehungen z. B. zu Johannes Oecolampadius im Falle von Ganteswiler). Im Zeichen des Konfessionskonfliktes war es scheinbar wichtig, sich in dem Stammland der zweiten Reformation Verbündete, intellektuelle Anregungen oder auch nur Ratschläge zu holen. Dass wir es hierbei mit ausschließlich Theologen zu tun haben, dürfte insgesamt kaum verwunderlich sein. Deshalb darf wohl mit Blick auf die Hola und Hanau gemutmaßt werden, dass die Hola-Professoren angesichts der noch recht neuen konfessionellen Verhältnisse nach der zweiten Reformation in der Grafschaft durch Philipp Ludwig II. der Kontakt zum reformierten Stammland „Schweiz“ wohl ein Akt der stetigen Selbstvergewisserung und zugleich Rückbindung an theologische Autoritäten war. Dies gilt es, mithilfe einer qualitativen Analyse der Briefe zu überprüfen.
Der zweite Teil des Korrespondenznetzwerkes besteht dagegen ebenfalls beinahe ausschließlich aus Theologen, allerdings verschieben sich die inhaltlichen Koordinaten des Netzwerks allein schon an den beteiligten Personen. Zum einen fällt auf, dass die Rolle der Schweiz erneut eine ganz erhebliche Rolle zu spiele scheint. Diese kristallisiert sich vor allem in den Personen von Peter und Samuel Werenfels. Die Rolle Peter Werenfells als ein Nukleus im Korrespondenznetzwerk ergibt sich aber auch aus seiner Rolle als Hofprediger Friedrich Casimirs. Daneben stellt die Person Anton Klinglers eine scheinbar imminent wichtige Schnittstelle zum einen zwischen dem Schweizer Kommunikationsraum und dem in England dar. Zum anderen ist gerade an dieser Stelle auffällig, dass die Rolle der Akademie der Wissenschaften in Berlin nicht nur neu, sondern eine ausnehmend zentral zu sein scheint. Dies hängt vor allem mit den Personen August Hermann Franckes und Daniel Ernst Jablonskis zusammen. Ersterer gilt als Begründer respektive Motor des Pietismus, letzterer war lange Jahre Hofprediger am Berliner Königshof. Zu beiden Personen hatten vor allem Bashuysen und Klingler intensive Kontakte und gerade diese Konstellation zeigt das Neue in diesem Teil des Korrespondenznetzwerkes auf: Die reformierte Konfession ist zwar in der Personenkonstellation abermals stark ausgeprägt, aber wir haben mit dem Pietismus nun ein neues, weiteres Element. Das Netzwerk spiegelt dabei die am Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts intensiv geführte Unionsdiskussion wieder, waren doch sowohl Francke als auch Jablonski in dieser
Thematik sehr engagiert. Die deutlich sichtbaren Querverbindungen zu englischen Geistlichen und zur Society für Promoting Christian Knowledge (SPCK) fallen in diesem Kontext ebenfalls ins Auge, handelt es sich doch um Geistliche, die ein Unionsprojekt zwischen reformierter und lutherischer Konfession laut den Studien Alexander Schunkas ebenfalls beförderten. Zudem ergeben sich Querverbindungen zu anderen reformierten Geistlichen mit ähnlicher intellektueller Ausrichtung, wie z. B. zum Genfer Theologen François Turrettini, der in Kontakt stand mit Johannes Zwinger, Peter Werenfels und Johannes I. Buxtorf. Einige dieser Persönlichkeiten. Samuel Werenfels, aber auch Francke und Jablonski waren wiederum Mitglieder in der SPCK. Es wird ein sehr enger Kommunikationszusammenhang über die Akademie der Wissenschaften in Berlin und der SPCK vermutlich über irenische, d. h. Unionsthemen deutlich. Insofern ist auch die Vermischung von politischen und theologischen Funktionen sowohl bei den Hola-Professoren als auch bei den Korrespondenzpartnern angesichts der engen Verwobenheit von Politik und Theologie nicht verwunderlich. Geprüft werden müssen diese Zusammenhänge natürlich noch mithilfe einer qualitativen Auswertung der Briefe.
Bei einer solchen qualitativen Auswertung muss zudem folgendes mitberücksichtigt werden: Ein Interessantes Merkmal des „jüngeren“ Teils dieses Korrespondenznetzwerkes ist es nämlich, dass der Diskurs sich nach außen hin zu öffnen scheint, und dass in zweierlei Hinsicht: Erstens erweitert sich der traditionelle reformierte Interaktionsraum um Pareus und Tossanus um Vertreter der lutherischen Orthodoxie (z. B. Crypian, Löscher). Sie werden in den mutmaßlich irenischen Diskurs mit einbezogen. Zweitens weitetet sich mit Blick auf die Hola das akademische Spektrum: neben Theologen – die weiterhin die Mehrheit bilden – treten Juristen (Zaunschliffer) oder Naturforscher (Cregut) auf den Plan, die zudem wiederum Querverbindungen zu neuen Akademien wie der damals noch jungen Leopoldina aufbauen. Insofern deutet sich hier etwas an, was dann im späten 18. Jahrhundert relevant wird: eine Auffächerung akademischen Wissens in andere Spezialgebiete hinein. Gerade hierfür ist auch die Person Bashuysen von Interesse. Er stand laut Martin Mulsow als reformierter Theologe eng mit Vertretern der Frühaufklärung in Kontakt und strebte den Gottesbeweis aus der reinen Vernunft, mithin eine Verbindung zwischen Religion und Vernunft an – wenn natürlich noch mit einem Schwerpunkt auf der Religion als erste Bezugswissenschaft.
B Auswertung zum Korrespondenznetzwerk im 18. und frühen 19. Jahrhundert (Bild 2):
Eingangs sei gleich darauf hingewiesen, dass es zwischen dem älteren Korrespondenznetzwerk und dem der jüngeren Hola-Professoren in der Tat Verbindungslinien gibt. Neben der Akademie der Wissenschaft ist dies vor allem die Person Albrecht von Hallers, die im fortgeschrittenem Altern Kontakte zu den Korrespondenzpartnern der jungen Hola-Professoren-Generation unterhielt. Generell ändern sich aber in dieser Zeitspanne die inhaltlichen Koordinaten des Korrespondenznetzwerkes:
Viele der an der Hola ganz oder zeitweilig unterrichtenden Professoren waren zeitgleich auch an der Universität Marburg und erhielten dort ihre akademische Ausbildung (Daub, Endemann, Kopp, Zimmermann). Hier trafen sie aber auch spätere Kontakte, so dass ein vielleicht frühzeitiges Kennenlernen in Jugendjahren oftmals anzunehmen ist (z. B. Daub, Creuzer). Dass dann später vor allem im Umkreis von Daub die Kontakte zu Professorenkollegen an der Universität Heidelberg hinzutraten, liegt in der Natur der Sache.
Dabei pflegten viele der Professoren im Laufe ihrer akademischen Karriere Kontakte zu hohen politischen Ämtern. Dies betrifft vor allem die schon fast als international zu bezeichnenden Kontakte Cancrins (Kassel, Wien, St. Petersburg), aber auch die von Suabedissen im deutschen Raum (Berlin, Kassel).
In den Kontakten der Hola-Professoren kristallisieren sich zudem einige Kontenpunkte heraus: Zum einen ist dies die Schiene über den preußischen Kultusminister Stein von Altenstein und der Akademie der Wissenschaften in Berlin, zum anderen über die Person Goethes. In seiner Person laufen viele Kontaktfäden zusammen. Insofern waren die Hola-Professoren gut vernetzt mit Persönlichkeiten rund um die so genannte Weimarer Klassik. Dies betrifft aber auch andere Vereinigungen wie beispielsweise den Nordsternbund um Chamisso, dem z. B. Wolfart und La Foyé angehörten. In den hessischen Raum erstreckten sich diese Kontakte dann vor allem mittels Jakob und Wilhelm Grimm, die hier wiederum den Nukleus von Kontakten unter den im Netzwerk aufgezeigten Personen darstellten.
Ein weiterer Knotenpunkt bildeten die „modernen“ naturwissenschaftlichen Vereinigungen wie die Wetterauische Gesellschaft in Hanau oder aber die Societät der gesamten Mineralogie in Jena. Neben einigen der Hola-Professoren waren hier erneut viele der weiteren Kontaktpersonen Mitglieder.
Insgesamt zeichnet sich ein Bild des engen und intensiven Kommunikationszusammenhangs, der aber auch mutmaßlich von neuen Themen geprägt ist, wie noch im 17./18. Jahrhundert. Unabhängig reiner mathematischer Formeln und der puren Zahl an überlieferten Briefen erscheinen die Hola-Professoren mit ihrer intellektuellen Umwelt des frühen 19. Jahrhunderts eng verbunden gewesen zu sein. Wichtige Knotenpunkte wie Goethe, Jean Paul, Savigny, die Grimms oder das Umfeld um den späteren preußischen Kultusminister und Hardenberg-Vertrauten Stein von Altenstein sorgten dafür, dass die einzelnen Korrespondenznetzwerke um die Hola-Professoren herum miteinander verbunden wurden, so
dass sich ein großer Kommunikationsraum bildete. Das dabei auch „schräge Vögel“ wie Karl Christian Wolfart – der immerhin in einen Vergewaltigungsfall involviert war – einen prominenten Platz in diesem Kommunikationsnetzwerk inne hatten, verwundert angesichts der geistigen, politischen, ökonomischen und sozialen Mobilität der Revolutionsjahre unter dem Eindruck der Spätaufklärung nach 1789 kaum (einige der Korrespondenzpartner wie Suckow waren Freimaurer). Neue intellektuelle Gedankenräume eröffneten solchen Personen neue Betätigungsfelder (Mesmerismus). Insofern verwundert es auch nicht, dass viele Hola-Professoren, anders noch als ein halbes Jahrhundert zuvor, zwar auch eine theologische Ausbildung erhalten hatten (Suabedissen und Daub), später aber als Philosophen akademisch tätig waren. Ebenso verwundert das Reüssieren naturwissenschaftlich gebildeter Professoren wie Kopp oder Wolfart angesichts rasanter technischer Erfindungen im Kontext der Frühindustrialisierung ebenfalls nicht. Die gesamte Buntheit des frühen 19. Jahrhunderts kommt trotz sich abzeichnender Demagogenverfolgung der Ära Metternich zudem in der Person Karoline von Günderrodes zum Ausdruck, die mit Daub in Kontakt stand: Sie verliebte sich zunächst in Savigny und dann in Creuzer, der sie verließ. Sie brachte sich hieraufhin um. Allein in dieser Viererkonstellation kommt das neue Moment im Korrespondenznetzwerks des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts zum Ausdruck: weg von ernsten theologischen Fragen, hin zum Herz und Gefühl der Sturm und Drang-Zeit.